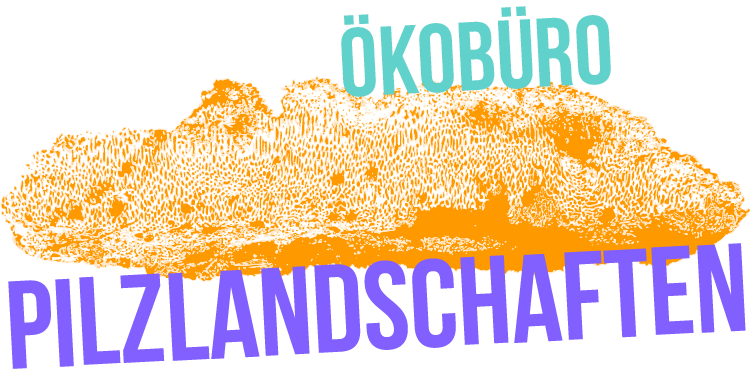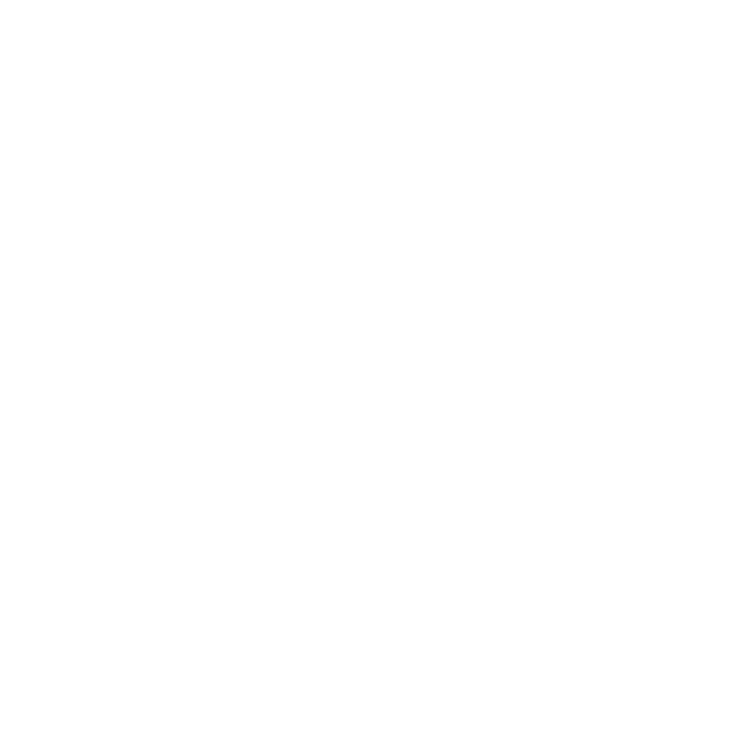Das wichtigste Instrument für den Schutz der Pilze in der Schweiz ist die Rote Liste der gefährdeten Grosspilze. Die Rote Liste dient als Grundlage für das Handeln der öffentlichen Institutionen mit Unterstützung des Bundes. Auf der Roten Liste basiert die Liste der National Prioritären Arten. Diese Grundlage stellt einen strategischen Rahmen für den praktischen Artenschutz nach Handlungspriorität.
Ökologische Bedeutung der Pilze
Mit mehr als 6’000 beschriebenen Arten und der Fähigkeit, nahezu alle Lebensräume zu besiedeln, machen Pilze einen bedeutenden Teil der Biodiversität aus. Zudem übernehmen sie bedeutende ökologische Funktionen im Zusammenleben mit anderen Organismen. Sei es als Symbionten, Parasiten oder in den Zersetzungsprozessen. Als Symbionten beliefern sie Pflanzen mit Nährstoffen und verbessern ihre Resistenz gegenüber Trockenheit und Krankheiten. Als Parasiten helfen die Pilze, ökologische Nischen zu schaffen und die Ökosysteme dynamisch zu halten.
Als Zersetzer bauen Pilze das abgestorbene organische Material ab, darunter Pflanzenreste und Totholz, wodurch sie Nährstoffe in den Boden freisetzen. Somit tragen sie zum Aufbau der Humusschicht bei und schaffen Lebensräume für andere Organismen.
Gefährdung der Pilze
Die Gefährdungsursachen in Bezug auf Pilze liegen hauptsächlich bei menschlichen Aktivitäten, die zum Habitatverlust oder Änderungen in der Habitatsqualität führen. Darunter zählen Bautätigkeiten, intensive Land- und Waldbewirtschaftung und Zerschneidung von Lebensräumen. Besonders gefährdet sind dabei Arten, die an magere Wiesen und Weiden gebunden sind. Überbauungen der landwirtschaftlich genutzten Flächen und Änderungen ihrer Nutzungsformen in den letzten 70 Jahren (intensiver Einsatz von Kunstdünger) haben zu grossen Verlusten an solchen Lebensräumen und zur Minderung ihrer Qualität geführt. Aber auch Pilze, die in den Wäldern vorkommen, sind von «Düngung» betroffen, obwohl ungewollt und unkontrolliert. Vom Stickstoff, der in den Waldböden durch die Luftverschmutzung deponiert wird, werden insbesondere die symbiotischen Mykorrhizapilze belastet. Der Einsatz schwerer Maschinen bei der Holzernte führt zur Zerstörung der Fruchtkörper und Belastung des Mycels durch Bodenstörung und -verdichtung. Rund ein Viertel aller in der Schweiz vorkommenden Waldarten sind an Totholz gebunden, was aber in unseren Wäldern als Folge der intensiven Waldbewirtschaftung fehlt. Alte Waldbestände weisen eine grosse Artenvielfalt aus und die intensive forstliche Nutzung hat zum Verlust solcher Bestände geführt. In der Schweiz sind die Wälder des Mittellands am stärksten betroffen.
Die mit dem Klimawandel verbundenen langen Trockenheitsperioden verursachen zusätzliche Belastung, da der Mangel an Niederschlägen und die damit einhergehende geringe Feuchtigkeit im Boden die Bildung von Fruchtkörpern vermindert und sogar zum Austrocknen des im Substrat verborgenen Mycels führen kann.
Biodiversität nd Naturschutz
Die Natur steht unter einem hohen Druck durch menschliche Aktivitäten, gleichzeitig ändert der Klimawandel die Dynamik der ökologischen Prozesse, von denen die Natur geprägt ist. Dabei ändern sich die Lebensräume von diversen Organismen und viele Lebensräume gehen verloren. Mit dem Verlust der Lebensräume verschwinden auch die Organismen, die an die Lebensräume gebunden sind. Diese Verluste führen zu einem markanten Rückgang der Biodiversität, und zwar oft unbemerkt. Um die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen für die Natur und den Menschen zu gewährleisten, besteht ein hoher Handlungsbedarf für Massnahmen, die dem anhaltenden Biodiversitätsverlust Gegensteuer geben können.
Pilzlandschaften engagiert sich für wirkungsvolle Massnahmen in den Bereichen Entwicklung und Unterhalt der Ökologischen Infrastruktur, Artenförderung und Sensibilisierung.